Meine sehr geehrten Damen und Herren,
was macht einen guten Künstler, eine gute Künstlerin aus? Eine dieser Gretchenfragen, werden Sie denken, bei denen nach so Grundsätzlichem gefragt wird, dass die Antwort zu komplex, zu lang und – zu anstrengend wäre. Stimmt! Aber auf eines können wir uns sicher kurz und bündig einigen: gute Künstler erkennt man ohne Namensschildchen an ihren Werken wieder. Und so ging es mir am Freitag auf der Pressekonferenz zur Ausstellung des Künstlerbundes Baden-Württemberg in der Städtischen Galerie Karlsruhe. Eine Fülle von Bildern war gerade mal gehängt, erfreulich viele Skulpturen und Objekte waren gestellt, aber etliche noch nicht mit Namen und Titel versehen. Darunter ein Hausboot von Gerda Bier, das gleichwohl für jeden, der ihr Oeuvre etwas kennt, auch ohne Angaben als ihre Arbeit identifizierbar ist. Mal abgesehen davon, dass allein die Mitgliedschaft im Künstlerbund Baden-Württemberg schon eine Qualitätsbestätigung ist, denn man kann dieser Künstlervereinigung nicht einfach beitreten sondern wird hineingewählt, was bei Gerda Bier vor drei Jahrzehnten geschah, – abgesehen davon also ist die Wiedererkennbarkeit der künstlerischen Handschrift ein Qualitätsmerkmal. Wenn diese Wiedererkennbarkeit dann nicht eine Manier im Sinne des Immer-Gleichen ist sondern etwas Charakteristisches innerhalb einer Vielfalt von Ausdrucksvarianten, wenn also im Schaffen Kreativität spürbar bleibt und sich nicht beliebige Wiederholbarkeit einstellt, dann werden wir als Ausstellungsbesucher und Betrachter wirklich gepackt, bleiben neugierig und willens uns auf jede Arbeit einzulassen und ihr Besonderes, ihr vielleicht auch Neues herauszuspüren.
Genau das ist bei Gerda Bier der Fall und deshalb ist sie zu Recht eine renommierte Künstlerin, die auf eine lange Reihe von Einzel- und Gruppenausstellungen seit den siebziger Jahren zurückblicken kann. Gerda Bier wurde in Schwäbisch Hall geboren, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Ihr Studium hat sie an der Staatlichen Akademie für Werkkunst und an der Hochschule der Künste Berlin absolviert, wo sie 1975 Meisterschülerin war. Seit 1976 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig und ist Mitglied der Darmstädter Sezession sowie – eingangs habe ich es bereits gesagt – Mitglied des Künstlerbundes Baden-Württemberg, der sie 1998 mit dem Erich-Heckel-Preis auszeichnete. 1998 ist auch das Entstehungsjahr der frühesten Arbeit in unserer Ausstellung, einer Materialcollage aus der Reihe Legare, was „binden, einbinden, auch verbunden sein“ bedeutet. Ansonsten finden sich Arbeiten ab 2005, die in einigen Fällen Jahre später überarbeitet und deutlich verändert wurden, was Sie an den doppelten Jahresangaben erkennen. Ein Beispiel hierfür ist der Große Turm, 2008/12, aus Holz und Eisen. Die Künstlerin hat ihn erweitert, um einen großen Balken rechts verlängert, dann links das Fehlstück aus Metall angesetzt und Eisen rechts unten angefügt. Ein kleines Tor lädt Miniaturfiguren zum Durchgehen ein. Zusammen mit neueren Arbeiten liegt der Ausstellungsschwerpunkt auf den letzten fünf Jahren. Dabei teilt sich das Oeuvre im Wesentlichen in Collagen und in dreidimensionale Objekte aus Holz, Eisen und Papier. Reliefs aus Holz und Eisen, wie sie unter anderen 2002 im Bahlinger Kunstverein zu sehen waren, sind dieses Mal nicht dabei. Gerda Bier erstellt gerne Variationen auf ein Thema, um alle in ihm angelegten Möglichkeiten auszuloten. Das sind dann meistens Werkreihen, gelegentlich aber auch – wie im Falle des Kleinen Torso II und III von 2014 und 2015 – eine Edition, bei der Konzeption und Größe aller Arbeiten gleich sind. Da es sich aber nicht um ein vervielfältigendes Verfahren handelt, sind die – in unserem Falle: sechs Torsi – allesamt Unikate, also Originale.
Wie ist es Ihnen ergangen, als Sie in diese Ausstellung gekommen sind oder vielleicht schon zuvor das erste Mal Arbeiten von Gerda Bier gesehen haben? Hat auch Sie, wie mich, die Aura ihrer Skulpturen in Bann gezogen, ohne dass Sie sich gleich über deren Wirkmechanismus im Klaren wurden? Oder waren es eher die Materialcollagen, die einen so verletzlichen und verletzten Eindruck machen? Haben Sie die handwerkliche Perfektion bestaunt, über das Material gerätselt, den Sinn der Werke reflektiert, zu dem – allerdings weniger in unserer Ausstellung – gelegentlich der Titel einen Hinweis gibt durch seine religiöse oder psychische Konnotation? Ich denke da an Titel wie Arche oder Seelenhaus …Was ist das Verbindende all dieser Arbeiten, das Charakteristikum? Ist es der inhaltliche Aspekt der überdeckten Verwundbarkeit, Dünnhäutigkeit in den fragilen Collagen oder der Hilflosigkeit, des Torsohaften bei den figurativen Skulpturen ohne Arme? Oder ist es der ebenso stark wirkende ästhetische Aspekt: Die Eleganz der Form, die Materialschönheit, der Reiz der Oberfläche, die Passgenauigkeit der Teile, die sich harmonisch zu einem Ganzen fügen mit den ersichtlichen Spuren früheren Gebrauchs, wie bei der Haut, an der Erlebtes sichtbar wird? Ich denke, beides macht das Faszinosum der Werke von Gerda Bier aus, weil die Ambivalenz aus ästhetischer Schönheit und inhaltlicher Verletzlichkeit, aus einem bleibenden Wesenhaften einerseits und einem vom Leben und seinen Gebrauchsspuren Gezeichneten in einer Balance gehalten werden.
Zu ihrem Ouevrekatalog von 2008 hat Harald Siebenmorgen, der frühere Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe, das Vorwort geschrieben und er bettet Gerda Biers Werk in die kunstgeschichtliche Entwicklung seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ein, verweist auf die Verwendung vorgefundener Gebrauchsmaterialien speziell seit Beginn des 20. Jahrhunderts, als das Bewusstsein für die Vergänglichkeit und eine Ästhetik des Hässlichen sich ganz neu artikulierten. In diesem Text hat mich ein Zitat aus Orhan Pamuks Roman Das Museum der Unschuld beeindruckt, in dem es heißt, die Vergangenheit wohne den Dingen wie eine Seele inne (zit. nach Siebenmorgen, S.2). Genau das macht Gerda Bier in ihren Werken anschaulich, auch die Ambiguität der Dinge. Nehmen wir ihre – offensichtlich weiblichen – Figuren, auf deren Körpersprache die Künstlerin dezidiert Wert legt, nicht durch naturalistische Wiedergabe sondern durch eine abstrahierende Konzentration auf das Wesentliche: Sie sind schlank und überlang, wirken fragil, zumal sie sich nach unten verjüngen und ihre stabile Standfläche erst durch den Sockel oder eine dünne Sockelplatte gegeben wird. Und doch scheint kein Sturm sie umwerfen zu können, denn sie haben eine gespannte Haltung des mehr oder weniger stark gebogenen Rückgrats, stehen aufrecht da oder sitzen majestätisch auf einem Thronsockel, mit dem sie geradezu verschmolzen sind ; ich beziehe mich hier speziell auf die Sitzende III.
Hat man Gerda Biers Werke einmal gesehen, so wird man sie immer wieder erkennen, weil ihr qualitätvolles Oeuvre relativ homogen und charakteristisch ist. Sie arbeitet mit gebrauchtem Holz aus alten Balken, Radspeichen und ähnlichem, das sie mit Eisen kombiniert. Ein Gebrauchsgegenstand kann als Ausgangsmaterial für das Kunstwerk dienen, das aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt wird, – eine additive Arbeitsweise wie bei der Collage, wobei das Ganze selbstverständlich mehr wird als nur die Summe der Einzelteile. Gerda Bier arbeitet materialbezogen, lotet die Möglichkeiten des Holzes und des Metalls aus. Holzstifte verbinden die Teile und das Eisen, das in den Holzkörper eingelegt wird, schließt genau an. Die Bandagen, die einige Figuren umgeben, sie einengen, aber auch stützen und halten, sind aus Bandeisen gefertigt, 3mm-Bändern, deren Stücke dann verschweißt und geschliffen werden. Die Holzoberfläche ist glatt, lässt aber darunterliegende Bearbeitungsspuren durchscheinen. Der rustikale Charakter der Materialkombinationen oder auch der reinen Metallskulpturen mit ihrer rostigen Patina steht mitunter in reizvoller Spannung zu den schlanken ausbalancierten Figuren, die – wie mir scheint – mit den Jahren etwas eleganter, geschwungener und „wie aus einem Guss“ geworden sind im Vergleich zu ähnlichen Werken der achtziger, neunziger Jahre.
Das Hausboot von 2010, das auch auf der Einladungskarte zu dieser Ausstellung abgebildet ist, führt auf seine Weise die den Arbeiten eigene Ambivalenz vor, hier rein inhaltlich, indem es das Zu-Hause-Sein, die Beheimatung, versinnbildlicht und das Unterwegs-Sein. In seiner kompakten, geschlossenen Form wirkt es so stabil, dass es auch in stürmischer See nicht untergehen wird. Dass es auch bei den Häuser-Serien nicht allein um vordergründige Architektur geht, sondern auf einer anderen Sinnebene auch um existenzielle Erfahrungen, wird an dem Gespaltenen Haus offensichtlich. Das gemeinsame Fundament bleibt, es trägt beide Teile, die doch auseinander streben; vergleichbar einer zwischenmenschlichen Beziehung, in der sich die Partner voneinander weg und getrennt weiterentwickeln, ohne dass doch die gemeinsame Vergangenheit ihre jeweils tragende Funktion verlieren würde.
Außer mit Holz und Eisen arbeitet Gerda Bier auch gerne mit Papier, – nicht nur in ihren Collagen, sondern auch in Kombination mit anderem Material in ihren dreidimensionalen Arbeiten. Dabei handelt es sich um von der Künstlerin handgeschöpftes Büttenpapier, das auf Karton gezogen ist. Wie entsteht dieses Büttenpapier? Aus einer Mischung von Papierstreifen aus dem Aktenvernichter, die mit Wasser und Tapetenkleber vermengt und zu einem Brei püriert werden. Diese materiell in sich gefärbte Masse wird in DinA-Format dünn aufgebracht, über einem Sieb ausgedrückt und dann zwischen Vliestücher gestapelt, gepresst und trocknen gelassen, wonach sich die Vliese leicht abziehen lassen. In den Collagen Verbindung I, Balance und Verbindung II aus diesem und dem vergangenen Jahr ist solches handgeschöpfte Papier verarbeitet, in dicken Lagen aufeinander geklebt, um einen plastischen Effekt zu erzielen. Und auch in den Labyrinthen findet es sich neben dünneren, durchscheinenden Papieren. Überhaupt sind die Papierarbeiten ein weiterer Beweis für den kreativen Einsatz von Materialien: Da werden Stoffe mit ersichtlichen Gebrauchsspuren verwendet, es wird Linolfarbe in Frottagetechnik aufgebracht und rudimentäre Gipsstreifen überziehen die Fläche.
Immer wieder assoziiert der Betrachter von Gerda Biers Werken existenzielle Erfahrungen oder religiöse Symbole. Das Haus mit den verschobenen Seitenwänden auf einem Stein nimmt Bezug auf die Arche, die auf dem Berg Ararat festen Halt fand wie der von den Wogen des Lebens umhergeworfene Mensch im Glauben an Gott als dem festen Felsen. Eine Präsentation der Liegenden an der Wand würde in ihrer Haltung durchaus an ein Kruzifix erinnern. Und das Labyrinth dient seit jeher als Sinnbild für die Unüberschaubarkeit unseres Lebensweges. Das Arbeiten in Schichten mit teils durchscheinenden Lagen und das reduzierte Kolorit der reliefartigen Collagen in Schwarz, Grau, Weiß und Brauntönen geben den Arbeiten einen geradezu meditativen Charakter. Auch hier hat Gerda Bier wieder Werkreihen geschaffen.
Ich wünsche der Ausstellung einen guten Erfolg, Ihnen viel Freude beim Rundgang und danke für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.
Martina Wehlte
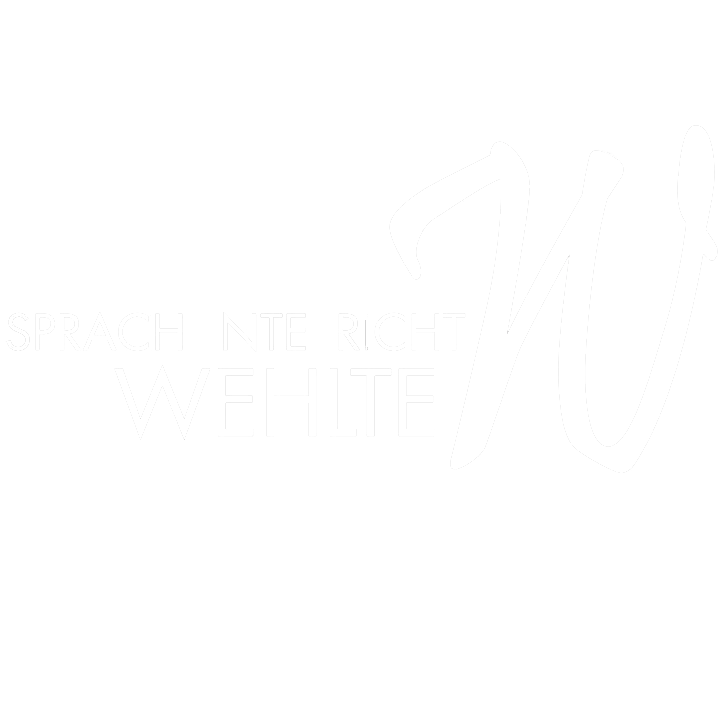
Comments are closed