Meine sehr geehrten Damen und Herren,
je höher man in der Kunstrangliste blickt desto weniger Frauen findet man. Nun ist das in allen Berufsgruppen so und die staatlich verordnete 30%-Vorgabe für Führungspositionen in Großunternehmen wird daran nichts ändern. Die Zahl herausragender Künstlerinnen ist – sogar international gesehen – recht überschaubar und als das Centre Pompidou 2010/2011 in einer groß angelegten Schau fünfhundert Arbeiten von zweihundert Künstlerinnen zeigte, stand auf dem Ausstellungsplakat. „Weniger als 5 Prozent der Künstler in den Moderne-Abteilungen sind Frauen, aber 85 Prozent der Nackten sind weiblich“. Je nach Perspektive kann man das als bittere Anklage oder als Kompliment nehmen. Nun möchte ich keiner speziellen Frauen-Kunstgeschichte das Wort reden. Da aber unsere Ausstellung von Werken Gerda Biers Anlass gibt, das Schaffen dieser Bildhauerin auch kurz im weiblichen Kunstspektrum zu reflektieren, habe ich überlegt, wer mir aus der Kunstgeschichte und aus den Ausstellungsbegegnungen der letzten Jahre spontan und in welcher Form vor Augen tritt.
Hildegard von Bingen und die Äbtissin Herrad von Landsberg, die im zwölften Jahrhundert hochgeschätzte Buchillustrationen fertigten, hatten im Mittelalter Alleinstellungsstatus. Einige erfolgreiche Künstlerinnen gab es in der Renaissance, speziell in Italien; im Barock brachten es dann – neben der berühmten Frankfurter Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian – einige wenige gefragte Stillebenmalerinnen und Porträtistinnen, die Künstlerfamilien entstammten, zu bleibendem Ruhm. Daran änderte sich im weiteren Geschichtsverlauf bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts kaum etwas, weil es die gesellschaftliche Rollenverteilung und die eingeschränkten Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen verhinderten.
Nach dem Ersten Weltkrieg traten etwas mehr Künstlerinnen an die Öffentlichkeit und wir bewundern in deutschen Museen Gemälde von Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter, Hannah Höch, Sonia Delaunay, Hannah Nagel und anderen. Heute sind zum Beispiel Rosemarie Trockel und Marlene Dumas international erfolgreich (ihnen ist gerade in der Städtischen Galerie Karlsruhe eine hervorragende Ausstellung gewidmet) oder Cindy Sherman und Jenny Holzer. Malerei und Zeichnung, Installationen und Objekte, Fotos und Videos sind ihre Medien; die Themen kreisen in einer Art Selbstbespiegelung um das gesellschaftliche Frauenbild, Sexualität und ein kritisches Rollenverständnis oder primär formal-ästhetische Aspekte im Spektrum von Abstraktion und konkreter Kunst.
Sucht man nach Bildhauerinnen, so ist das Resultat ausgesprochen dürftig: Spontan fallen einem Camille Claudel, Käthe Kollwitz, René Sintenis ein; später Louise Bourgeois und Rebecca Horn, die allerdings in den Bereich Installation mit verschiedenen Materialien vordrangen. Die Bildhauerei – zumal in Stein, Holz und Metall – ist durchaus keine weibliche Domäne. Das hat zum einen sicher seinen Grund in der physischen Anstrengung des Hauens, Sägens, Schnitzens und Schweißens. Zum anderen eignet sich das Medium Bildhauerei nicht für die genannten Themen und Aussageabsichten der meisten Künstlerinnen. So ist Gerda Bier mit ihrer künstlerischen Sprache und inhaltlichen Intention eine Ausnahmeerscheinung.
Gerda Biers qualitätvolles Oeuvre ist relativ homogen und charakteristisch, so dass man ein Werk von ihrer Hand ohne weiteres erkennt. Sie arbeitet mit gebrauchtem Holz aus alten Balken, Radspeichen, Türen und ähnlichem, das sie mit Eisen kombiniert. Diese Gebrauchsgegenstände dienen als Ausgangsmaterial für das Kunstwerk, das aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt wird, – eine additive Arbeitsweise wie bei der Collage, wobei das Ganze selbstverständlich mehr wird als nur die Summe der Einzelteile. Gerda Bier arbeitet materialbezogen, lotet die Möglichkeiten des Holzes und des Metalls aus. Holzstifte verbinden die Teile und das Eisen – Bandeisen – das in den Holzkörper eingelegt wird, schließt genau an. Die Holzoberfläche ist glatt geschliffen, lässt aber darunterliegende Bearbeitungsspuren der Vergangenheit durchscheinen.
Der rustikale Charakter der Materialkombinationen, das ersichtlich Zusammengesetzte der Holzteile, die rostige Patina des Eisens stehen mitunter in reizvoller Spannung zur Form, etwa bei der schlanken Liegenden Figur I mit den fragilen aufgestellten Beinen (1988), die für diese Ausstellung vom Hällisch-Fränkischen Museum Schwäbisch Hall entliehen wurde, und bei der elegant geschwungenen Körperhaltung der Liegenden Figur, sich aufrichtend von 1991. Beiden hat sich mit den Gebrauchsspuren des Holzes das Leben eingeschrieben wie in menschliche Haut. Sie haben wie alle Figuren bei Gerda Bier – außer den Kreuzfiguren – keine Arme zum Zupacken, sind nicht handlungsfähig, sind überlang und schutzlos. Beide Arbeiten haben eine dünne Bodenplatte als Tragfläche, während der Sockel in der Werkreihe der Seelenhäuser – hier durch eine Ausführung von 2004 vertreten – konstitutiver Bestandteil der Gesamtkomposition ist. Folgerichtig entwickelte sich daraus zwei Jahre später der Große Seelenturm von 2,50m Höhe.
Die Ausstellung hier in der Galerie im Prediger zeigt achtunddreißig Werke von Gerda Bier aus dreieinhalb Jahrzehnten, nämlich von 1983 bis heute. Künstlerisches Schaffen als lebenswichtiges Anliegen, das auch keinen Ruhestand kennt. Was ist dieses Anliegen bei Gerda Bier? Der Ausstellungstitel sagt dazu mehr, als es auf den ersten Blick scheinen will. Figur – dem Abstraktionsgrad nach eigentlich eher die Assoziation von Figur – und Gehäus – also Haus, Turm, Schiff – sind äußerlich verschiedene Erscheinungsformen der menschlichen Existenz in Grundsituationen: Der liegende Körper, der sich aufrichtende oder sprungbereite, der in Kreuzform leidende Körper; das Haus als schützende Heimstatt, der aufragende Turm, das ins Unbekannte fahrende Schiff – es sind Metaphern für das Leben. Vom Gedächtnis der Dinge – so der Untertitel – bezieht sich auf die Gebrauchsspuren des verarbeiteten Materials, seine Biografie gewissermaßen. Er bezieht sich im übertragenen Sinn aber auch auf die Seele als Summe unserer Erinnerungen, wie es ja einige Werktitel ausdrücklich nahelegen.
Das Motiv des Hausboots (Hausboot von 2010) führt auf seine Weise die den Arbeiten eigene Ambivalenz vor, hier rein inhaltlich, indem es das Zu-Hause-Sein, die Beheimatung, versinnbildlicht und das Unterwegs-Sein. In seiner kompakten, geschlossenen Form wirkt es so stabil, dass es selbst in stürmischer See nicht untergehen wird. Dass es auch bei den Häuser-Serien nicht um vordergründige Architektur geht, sondern auf einer anderen Sinnebene um existenzielle Erfahrungen, wird an dem Gespaltenen Haus offensichtlich. Das gemeinsame Fundament bleibt, es trägt beide Teile, die doch auseinander streben; vergleichbar einer zwischenmenschlichen Beziehung, in der sich die Partner voneinander weg- und getrennt weiterentwickeln, ohne dass doch die gemeinsame Vergangenheit ihre jeweils tragende Funktion verlieren würde.
Unverrückbare Monumente des Veränderlichen in Zeit und Raum, der Vergänglichkeit, sind die beiden zweieinhalb Meter hohen Stelen Große Stele I (2010) und II (2012): Kompakt von rostigem Eisen umschlossene Holzblöcke auf niedrigen Sockelplatten, stehen sie in stummem Dialog aufeinander bezogen im Galerieraum. Das ausgebleichte Holz weist Auskerbungen und durchgängige Löcher auf, durch die man hindurchschauen kann. Risse zeugen von den Spannungen des Materials und den Einflüssen der Witterung. Gut eingepasst in seine metallene Umhüllung, ist das Holz doch nicht mit ihr zur Einheit verschmolzen sondern wird eher stabilisiert. Erst zusammen entfalten sie ihre Kraft und es wird die Ambiguität der eisernen Form anschaulich, die ihr naturwüchsiges Inneres zwar einengt, aber auch stützt und hält, – ganz wie die Bandeisen einige der Figuren Gerda Biers wortwörtlich bandagieren, also gleichermaßen schützen und hemmen. Aus dem Verständnis des künstlerischen Gesamtwerks heraus, das sowohl psychologische Konnotationen als auch symbolhafte religiöse Bezüge erkennen lässt, darf in diesem Ensemble eine Metapher der verletzlichen Existenz schlechthin gesehen werden.
Gerda Bier kann auf eine lange Reihe von Einzel- und Gruppenausstellungen seit den siebziger Jahren zurückblicken. Sie wurde in Schwäbisch Hall geboren, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Ihr Studium hat sie an der Staatlichen Akademie für Werkkunst und an der Hochschule der Künste Berlin absolviert, wo sie 1975 Meisterschülerin war. Seit 1976 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig und ist Mitglied der Darmstädter Sezession sowie des Künstlerbundes Baden-Württemberg, der sie 1998 mit dem Erich-Heckel-Preis auszeichnete. Sie arbeitet vorzugsweise in Werkreihen und –zyklen, in denen sie eine Vielfalt von Ausdrucksvarianten erprobt, ohne in eine Manier im Sinne des Immer-Gleichen zu verfallen. Diese Kreativität packt den Betrachter, macht uns neugierig und willens uns auf jede Arbeit einzulassen und ihr Besonderes herauszuspüren. Ihre handwerkliche Perfektion besticht ganz besonders in der nahen Anschauung ihrer ruhigen, fast meditativ wirkenden Innenraumskulpturen. Durch die Bearbeitung erhält das vermeintlich wertlose, alte Holz eine neue Schönheit, die gleichzeitig seine Verletzlichkeit sichtbar macht. Eine faszinierende Ambivalenz!
Für einige Werke hat die Künstlerin Papier verwendet, zum Beispiel für das schon genannte Hausboot I und für die Arche von 2007, eine Papiercollage auf Sandstein. Dabei handelt es sich um von der Künstlerin handgeschöpftes Büttenpapier, das auf Karton gezogen ist. Wie entsteht dieses Büttenpapier? Aus einer Mischung von Papierstreifen aus dem Aktenvernichter, die mit Wasser und Tapetenkleber vermengt und zu einem Brei püriert werden. Diese in sich gefärbte Masse wird zwischen Vliestücher gestapelt, gepresst und trocknen gelassen, wonach sich die Vliese leicht abziehen lassen. Immer wieder wird man bei Gerda Biers Arbeiten durch Werktitel auf religiöse Symbole und biblische Geschichten verwiesen oder assoziiert man existenzielle Erfahrungen. Das Papier-Haus mit den verschobenen Seitenwänden auf einem Sandstein nimmt Bezug auf die Arche, die auf dem Berg Ararat festen Halt fand wie der von den Wogen des Lebens umhergeworfene Mensch im Glauben an Gott als dem festen Felsen. Im Vordergrund steht allerdings nicht eine streng religiöse Sinngebung christlicher Prägung sondern ein weiter gefasstes Verständnis von Transzendenz und innerer Verbindung, eine Beseelung der Dinge. Wir haben keine Kunst des Leidens vor Augen, die uns in einen depressiven Sog ziehen würde. Die Vergänglichkeit, der Tod werden nicht tabuisiert oder als mahnendes Memento Mori verstanden sondern als natürlicher Bestandteil des fortwährenden Verwandlungsprozesses der lebendigen Natur.
So hat sich Gerda Bier auch von der Tradition den Ahnen gewidmeter Häuschen in den indonesischen Reisfeldern beeindrucken lassen und der damit verbundenen Nachkommenverpflichtung, für die Ahnen durch besondere Speisen und kleine Geschenke zu sorgen. Die an der Galeriewand angebrachten Bretter gehören zu einer Werkreihe, die durch sogenannte Totenbretter inspiriert wurde. Das waren Holzbretter auf denen in ländlichen Gegenden während der kalten Jahreszeit Tote bis zum Begräbnis aufgebahrt wurden und die danach zur Erinnerung am Wegesrand oder an einer Kapellenwand entlang aufgestellt wurden. Der Brauch war im neunzehnten Jahrhundert besonders in Bayern verbreitet und entwickelte sich hin zur künstlerischen Gestaltung schmaler Gedenkbretter mit Sinnsprüchen. Der Volksglaube besagte, dass die Seele des Toten erst erlöst würde, wenn sein Totenbrett verfallen sei. Die Präsenz der Vergangenheit, eine zeitüberspannende Verbundenheit sinnbildhaft sichtbar zu machen, im scheinbar Hässlichen das Schöne herauszuarbeiten und aus Altem etwas Neues zu erschaffen, das ist der Kern von Gerda Biers Kunst. Sie macht Zeit geradezu anschaulich und lässt so das Werk in der Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart zeitlos erscheinen.
Martina Wehlte
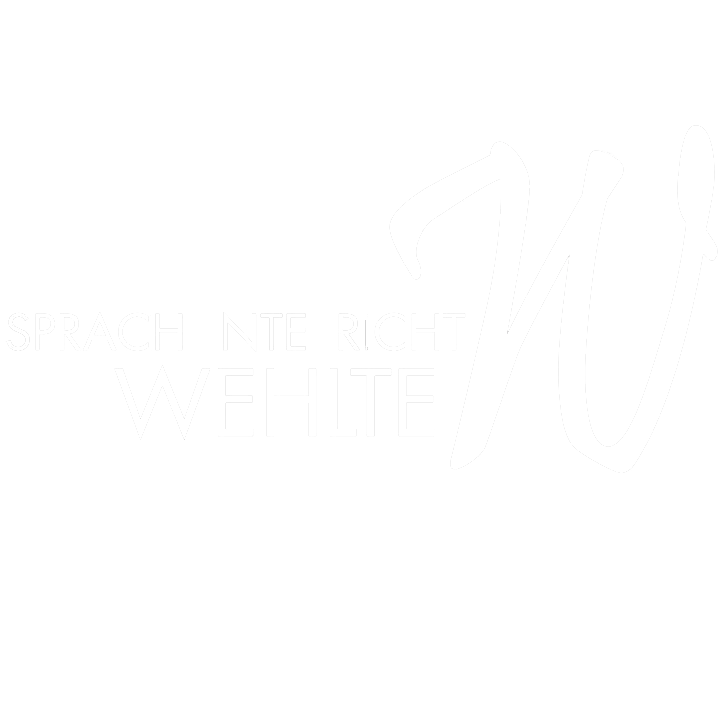
Comments are closed